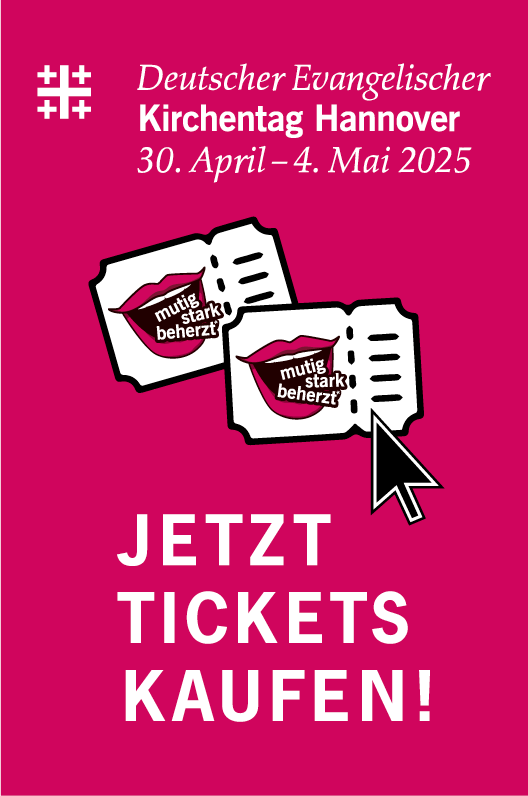Hannover. Der evangelische Pastor Marcus Christ ist seit Februar neuer Polizeiseelsorger der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen. Besonders nach problematischen Situationen wie dem Gebrauch der Schusswaffe sei er als Ansprechpartner gefragt, erläutert er im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd).
Herr Christ, wie sind Ihre ersten Erfahrungen? Wann wünschen sich Polizistinnen und Polizisten die Unterstützung durch einen Seelsorger?
Marcus Christ: Das ist zum Beispiel nach einem Schusswaffengebrauch der Fall, damit hatte ich bereits zu tun. Wenn ein Beamter oder eine Beamtin im Dienst auf einen Menschen schießt, wird anschließend vorsorglich ein Strafverfahren eingeleitet. Nach einem Schusswaffengebrauch wird den Polizisten deshalb häufig erst einmal geraten, sich nicht zu äußern.
Dabei geht es auch um das sogenannte Legalitätsprinzip: Wenn Polizeibeamte untereinander sich austauschen und der eine vertraut dem anderen an, dass er etwas falsch gemacht hat, das strafrechtlich relevant ist, dann müsste der andere Polizeibeamte das zur Anzeige bringen. Sonst würde er sich selbst strafbar machen.
Und wie ist das bei Ihnen?
Christ: Bei mir ist das anders. Ich bin als Seelsorger zur Verschwiegenheit verpflichtet. Bei Schusswaffengebrauch holen die mich gern dazu, um im Zweifel das Legalitätsprinzip nicht anwenden zu müssen. Das war auch in dem Fall der tödlichen Schüsse auf einen Gambier Ende März in Nienburg so. Da hat ja die Staatsanwaltschaft Verden die Ermittlungen gegen 14 am damaligen Einsatz beteiligte Polizisten kürzlich eingestellt. Sie haben im Rahmen der Gesetze gehandelt.
In dem Fall wurden den Einsatzkräften auch rassistische Motive vorgeworfen. Was löst das in ihnen aus?
Christ: Es belastet sie, sich unterstellen zu lassen, sie hätten rassistisch gehandelt. Und sie haben nicht die Möglichkeit, sich öffentlich dagegen zu wenden. Sie können dann auch nichts richtigstellen. Sie müssen stillhalten und warten und darauf vertrauen, dass der Rechtsstaat richtig handelt.
Eine aktuelle Studie verweist allerdings auf Strukturen bei der Polizei, die ein diskriminierendes und auch rassistisches Verhalten fördern.
Christ: Die Studie beschreibt einige Dilemma-Situationen. Beispielsweise wenn Einsatzkräfte zu gewalttätigen Einsatzlagen gerufen werden, wie einem Messerangriff, und ein Beteiligter ist bekannt, dann wird vorher im polizeilichen Erfassungssystem überprüft, was er auf dem Kerbholz hat. Es ist dann natürlich ein Warnlämpchen für die Beamten vor Ort, wenn da steht, er sei als aggressiv bekannt. Auf so jemanden gehen sie anders zu als zum Beispiel auf eine ältere Dame, der die Handtasche gestohlen wurde. Es kann aber auch sein, dass jemand, der schon Körperverletzungen begangen hat, in diesem Fall das Opfer ist.
Die Studie sagt, dass die Einträge in den polizeilichen Datenbanken auf solche Weise stigmatisierend wirken können. Aber gleichzeitig können die Informationen im Rahmen der Gefahrenabwehr sinnvoll sein. Ein Vorgesetzter hat auch Verantwortung, wenn er Mitarbeiter in eine solche Situation schickt. Es ist dennoch wichtig, dass die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wahrnehmen, dass bestimmte Kategorisierungen auch problematisch sein können.
Bei der Polizei zu arbeiten kann auch bedeuten, in Lebensgefahr zu geraten. Was macht das mit den Menschen?
Christ: Eine der schlimmsten traumatischen Erfahrungen ist Hilflosigkeit. So weiß ich von Polizeibeamten, die es sehr belastet hat, dass er einmal in den Lauf einer Waffe geschaut und gedacht hat, das ist jetzt das Ende. Es hat sich dann herausgestellt, es handelte sich um eine Schreckschusswaffe. Aber die belastende Situation hat es dennoch gegeben. Die Schrecksekunden haben sich eingebrannt. Oft helfen sich dann die Kolleginnen und Kollegen untereinander.
Es gibt auch eine Plattform im Internet, die sich mit dem Schusswaffengebrauch im Dienst auseinandersetzt, da haben Polizisten eine Art Selbsthilfegruppe gegründet. Unter ihnen gibt es solche, die nicht mehr dienstfähig waren. Andere haben den Dienstbereich gewechselt.
Es ist generell eine schockierende Erfahrung, wenn jemandem Gewalt begegnet. Davon wird auch das eigene Wertemodell erschüttert. Wie ist ein Mensch dazu fähig, seine Ehefrau zu töten? Wie kann jemand aus verletzter Eitelkeit Häuser in Brand setzen? In solchen Fragen bietet die Seelsorge einen geschützten Raum für Gespräche.
Sie unterrichten auch an der Polizeiakademie. Was interessiert die Studierenden?
Christ: Der Unterricht vermittelt auch Praktisches, wie das Überbringen von Todesnachrichten. Bei dem Thema sind alle sehr aufmerksam, das ist ein Angstthema. Manche fühlen sich dabei für eine Situation verantwortlich, die sie nicht zu verantworten haben. Der Polizist kann nichts dafür, er überbringt nur eine Nachricht. Aber er hat den Finger am Klingelknopf und weiß, mit seiner Nachricht wird er das Leben eines Menschen massiv verändern.
Es geht dann darum auszuhalten, was da geschieht. Die Reaktionen gehen vom lauten Schreien bis zum Verstummen - dahin, es nicht glauben zu können. Die Polizisten schauen dann vor allem: Wo gibt es ein soziales Netz, das die Menschen auffangen kann? Sie können sich auch Hilfe suchen, zum Beispiel von Notfallseelsorgern.