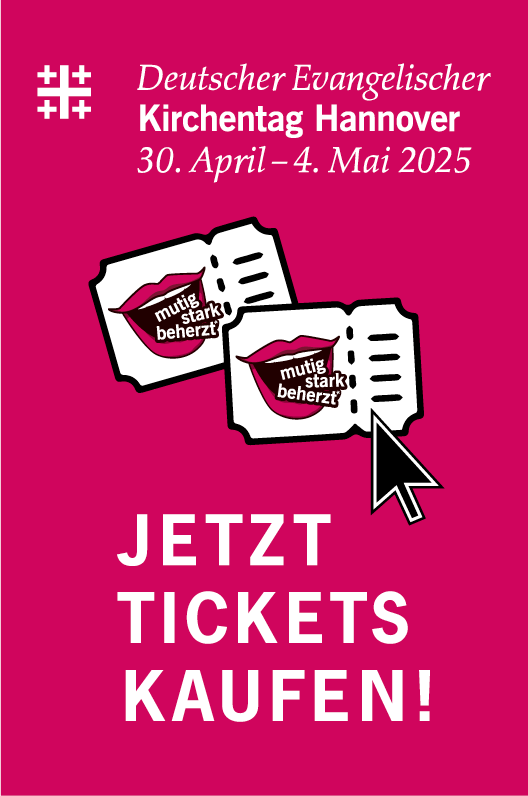Loccum. Wie politisch darf die Kirche sein? Wie politisch muss sie vielleicht sogar sein, wenn sie die Bibel ernst nimmt? Darüber gehen die Meinungen weit auseinander – auch bei einer Tagung der Evangelischen Akademie Loccum, die unter dem Titel „Macht. Glaube. Politik?“ mit Vertreterinnen und Vertretern aus Kirche, Politik und Medien einen „Dialogversuch zwischen protestantischer Kirche und politischer Praxis“ unternahm.
„Wenn bei der EKD jemand so twittern würde, wie Luther gesprochen hat, würde es ständig retweetet“, sagte Sven Giegold. Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium (Grüne) brachte damit ein Problem auf den Punkt, das neben der Frage nach dem Politischen immer mitschwang: Wie kann die Kirche ihre Botschaften medial vermitteln? Und wie relevant ist ihre Stimme noch in den gegenwärtigen gesellschaftlichen Debatten?
Giegold, Mitbegründer von Attac, langjähriger Europaabgeordneter und Mitglied im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentags, hat seinen Teil dazu beigetragen, dass die Aktivitäten der Kirche als überwiegend links-grün wahrgenommen werden. Er war treibende Kraft bei der Gründung des Seenotrettungs-Bündnisses „United4Rescue“, für das sich auch Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm als EKD-Ratsvorsitzender stark gemacht hat. „Wir schicken ein Schiff“ lautete der Slogan für das kirchliche Engagement, das sowohl Befürworter wie Kritiker auf den Plan rief. Letztere geben zu bedenken, dass die Seenotrettung letztlich das Geschäft von Schlepperbanden festige. Befürworter wie Bedford-Strohm halten sich an die zentrale Predigtaussage im Schlussgottesdienst des Dortmunder Kirchentags: „Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.“
Der ehemalige EKD-Vizepräsident Horst Gorski gewährte Einblicke hinter die Kulissen der damaligen Entscheidungsfindung. Der Rat der EKD habe sich Gedanken gemacht, ob die politische Botschaft hinter dem symbolischen Akt, ein Schiff zu schicken, durchdringt: dass es nämlich darum gehe, die Fluchtursachen zu bekämpfen und auf die Tatenlosigkeit der Politik hinzuweisen. „Heinrich Bedford-Strohm hat das in jedem Interview gesagt.“ Dennoch sei in der medialen Verkürzung nur das „EKD-Schiff“ als starkes Bild wahrgenommen worden.
„Konsens bis zur Langweiligkeit“

„Seenotrettung bedeutet nicht automatisch, dass es ein Recht auf Einreise gibt“, merkte denn auch die FDP-Bundestagsabgeordnete und EKD-Synodale Linda Teuteberg an. Doch was heißt das im Umkehrschluss? „Oder soll man es lassen?“ lautete eine heftig kritisierte Überschrift der Wochenzeitung „Die Zeit“ zum Thema Seenotrettung. Sven Giegold jedenfalls zeigte Verständnis für diejenigen, die in diesem konkreten Fall ein „grünes Projekt“ sehen. Er sei deshalb der Schiffstaufe der „Sea-Watch 4“ bewusst ferngeblieben und nannte es „symbolisch falsch“, dass mit der damaligen Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtages, Aminata Touré, eine grüne Politikerin das Schiff taufte.
Ähnlich wurde in Loccum über das Thema Klimaschutz diskutiert – der Rat der EKD war seinerzeit in Hannover gemeinsam mit „Fridays for Future“ auf die Straße gegangen. „Klimaschutz heißt nicht, dass die Forderungen der ‚Letzten Generation‘ das einzige Mittel sind“, sagte Teuteberg. Bedford-Strohm erwiderte, ihm gehe es um gemeinsame Grundüberzeugungen. „Man sollte uns nicht unterstellen, dass wir konkreten Maßnahmen einen Heiligenschein geben.“
Zugleich sei die Vielstimmigkeit innerhalb der evangelischen Kirche ein Problem, gab die ehemalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) zu bedenken: „Je breiter die Diskussionslinien, desto weniger Einfluss hat die evangelische Kirche auf die Politik.“ In vielen EKD-Denkschriften dominiere ein „Konsens bis zur Langweiligkeit“, weshalb der Deutsche Ethikrat heute die Rolle einnehme, „die wir früher eher bei den Kirchen gesucht haben“.
Im Ethikrat ist die Kirche mit Hannovers Regionalbischöfin Petra Bahr indes vertreten. Sie wies darauf hin, dass auch dort eine gemeinsame Linie gefunden werden müsse, bevor eine Stellungnahme öffentlich wird. „Was die Debatten angeht, ist es beim Ethikrat nicht anders als bei der EKD, inklusive Türenknallen.“ Horst Gorski beklagte eine „Diskrepanz zwischen Tempo und Tiefenbohrung“. Die Politik stehe wahnsinnig unter Druck, die Meinungsbildung finde oft schon im Internet statt, bevor es ins Parlament gehe. „Wie soll man da als EKD noch hinterherkommen und Gehör finden?“ Als Beispiel nannte er die Diskussion über eine neue Friedensdenkschrift, für die man eigentlich fünf Jahre bräuchte. Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine heiße es nun, sie müsse in zwei Jahren fertig sein.
„Strukturelle Haltung des Beleidigtseins“

Als die Journalistin und Autorin Christiane Florin (Deutschlandfunk) ausführte, dass sie bei weiteren Themen eine ernsthafte Debatte innerhalb der Kirche vermisse, etwa im Umgang mit Hass und Rassismus in den eigenen Reihen, wie sie sich nach der Kirchentagspredigt von Quinton Ceasar offenbart hätten, widersprach Gorski. Dies sei vielfach geschehen, es finde nur in den Medien keinen Widerhall. Florin verwies auf ihre Arbeit in der Redaktion „Religion und Gesellschaft“, in der man durchaus über die kirchlichen Veröffentlichungen im Bilde sei. „Wir nehmen Sie schon intensiver wahr als andere Redaktionen.“ Dass andere dies nicht tun, sei nicht ihr Problem, sondern das der Kirche. Eine „strukturelle Haltung des Beleidigtseins“ bringe nichts. „Wer etwas zu sagen hat, wird gehört.“
Es bleibt das Legitimationsproblem. Dass Heinrich Bedford-Strohm als EKD-Ratsvorsitzender nicht für alle Strömungen innerhalb der evangelischen Kirche gesprochen hat, wurde ihm in Loccum deutlich gespiegelt. Beistand bekam er von Sven Giegold: „Es geht nicht darum, dass man Konservative nicht erschreckt. Wenn wir uns nur an den E-Mail-Frequenzen ausrichten, können wir es auch lassen mit dem Christentum.“ Allerdings hatte er einen Alternativvorschlag. „Ich verstehe Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden.“ Auch viele Politikerinnen und Politiker seien aus ihrem Glauben heraus aktiv. „Ich würde mir manchmal wünschen, dass die Kirche das mehr nutzt.“