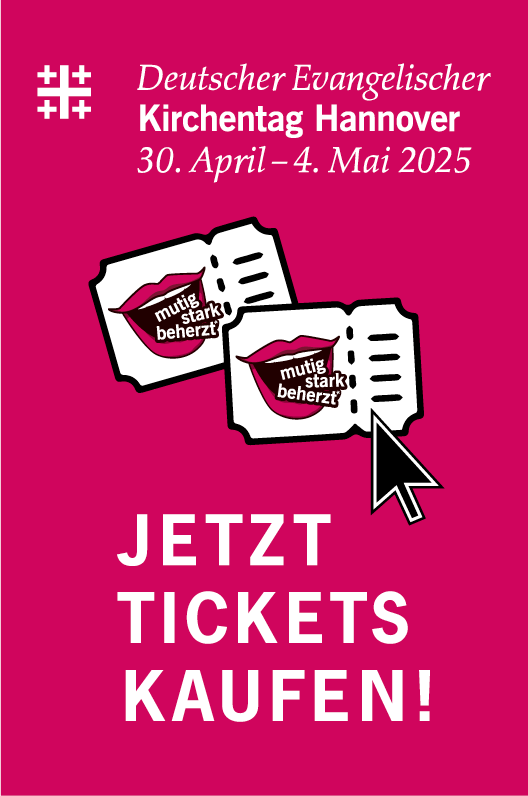In einer Podiumsdiskussion zum Thema „Zeit der Hoffnung – Kirchen als Akteure im Überwinden von Krieg und Konflikten“ saßen KirchenvertreterInnen aus der Ukraine und Russland an einem Tisch und gaben Einblick in die aktuelle kirchliche Arbeit im Krieg.
Zum Thema „Zeit der Hoffnung – Kirchen als Akteure im Überwinden von Krieg und Konflikten“ versammelte die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa GEKE am 30. August im rumänischen Hermannstadt/Sibiu in einem Gespräch Vertreter aus Nordirland, Kroatien, Ukraine und Russland. Die Podiumsdiskussion fand in der Evangelischen Stadtpfarrkirche statt.
Olexandr Gross von der Deutschen Evangelischen Kirche in der Ukraine DELKU erinnerte daran, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion 14 Teilrepubliken zufrieden über ihr Schicksal gewesen seien und eine eben nicht. Putin hätte dann den Versuch gestartet, das alte Imperium wieder aufzubauen. „Wir haben gelernt, mit dem Krieg zu leben“, sagte der Synodenpräsident der DELKU, und weiter: „wir wissen in der Ukraine, jeder Tag kann der letzte sein.“
Als Zeichen der Hoffnung habe seine Kirche in den letzten Jahren drei neue Kinderspielplätze gebaut, Essen verteilt, bei der medizinischen Versorgung der Armee geholfen und zwei Mal in der Woche Gottesdienste abgehalten, um Menschen Raum für Hoffnung und Gebet zu geben.
Derzeit sei in den meisten Gebieten nur drei Stunden am Tag Elektrizität vorhanden. Aufgrund dieser extremen Bedingungen würden immer noch viele Menschen die Ukraine verlassen und flüchten, um ein besseres Leben zu haben.
Der Rektor des theologischen Seminars der lutherischen Kirche Russlands, Anton Tikhomirov aus St. Petersburg gab zu bedenken, dass die Welt derzeit nicht in Ordnung sei. Bei dem derzeitigen Konflikt, so Tikhomirov, der auch Stellvertretender Erzbischof der Lutherischen Kirche Russlands ist, müsse man auch bedenken, dass viele Menschen in Russland betroffen seien. Auch auf der russischen Seite gebe es Gefallene und Geflüchtete. Seine Kirche würde weiter für den Frieden beten und die Beziehungen zu den ukrainischen Schwestern und Brüdern weiterhin pflegen. „Wir haben aber auch gelernt“, so Tikhomirov, „zu schweigen und nicht die Wunden zu berühren“.
Von Narben, die zum Unterschied zu blauen Flecken nicht heilen können, sprach auch Pfarrer Dr. David Bryce, ehemaliger Moderator der Presbyterianischen Kirche in Irland, der als junger Mann einen guten Freund bei einem IRA-Attentat verlor. „Morde standen an der Tagesordnung, doch als mein Freund ermordet wurde, stürzte mich dies in eine schwere Krise. Ich habe in den letzten 45 Jahren jeden Tag daran gedacht und der Verlust formte mich und meine Arbeit in der Kirche“. Dennoch sei für ihn Jesu Aufforderung, seine Feinde zu lieben, ein Weg in die Verwöhnung. In Nordirland bedeutet das, dass man Vertrauen schafft, wo es verloren wurde. Im gleichen Raum sein. Vielleicht sitzt man dann gemeinsam am selben Tisch und fängt eine Beziehung an.“
Von der wichtigen Bedeutung des langfristigen Beziehungsaufbaus sprach auch Christine Schliesser, PD Dr. Christine Schliesser ist Studienleiterin am ökumenischen Zentrum für Glaube und Gesellschaft der Universität Fribourg und Privatdozentin für Systematische Theologie und Ethik an der Universität Zürich.Theologieprofessorin in Zürich und, die im Ruanda-Konflikt den Versöhnungsprozess mitbegleitet. Mit dem Projekt „Kühe für den Frieden“, in denen sich Täter und Opfer gemeinsam um eine Kuh kümmern, könne langsam eine Beziehung aufgebaut werden. Die Kirche spiele in Ruanda eine wichtige Rolle im Versöhnungsprozess, da 90% gläubige ChristInnen seien, so Schliesser.
Samir Vrabec, Pastor der evangelischen Kirche in Osijek, der als Jugendlicher den Krieg in Kroatien miterlebt hat, war ebenfalls Gast am Podium. Er habe gemischte Gefühle gehabt, als er gefragt worden war, an der Podiumsdiskussion teilzunehmen. „Ich bin noch nicht bereit, so tiefgreifend Zeugnis über die Kriegszeit abzulegen. Aber ich kann darüber sprechen, wie ich den Krieg erlebt habe.“ Was Samir Vrabec Kraft gab, war die Gemeinschaft der Kirche zu erleben, in der der reformierte Pfarrer übrigens auch die verwaiste lutherische Gemeinde mitbetreute. Die Ökumene reichte aber noch weiter: „Das stärkste Zeichen war, als unser reformierter Pfarrer Beerdigungen für orthodoxe Gläubige abgehalten hat."
Übereinstimmung fanden die Teilnehmenden darin, dass langfristiger Beziehungsaufbau das wichtigste Element von Versöhnungsprozessen sei.