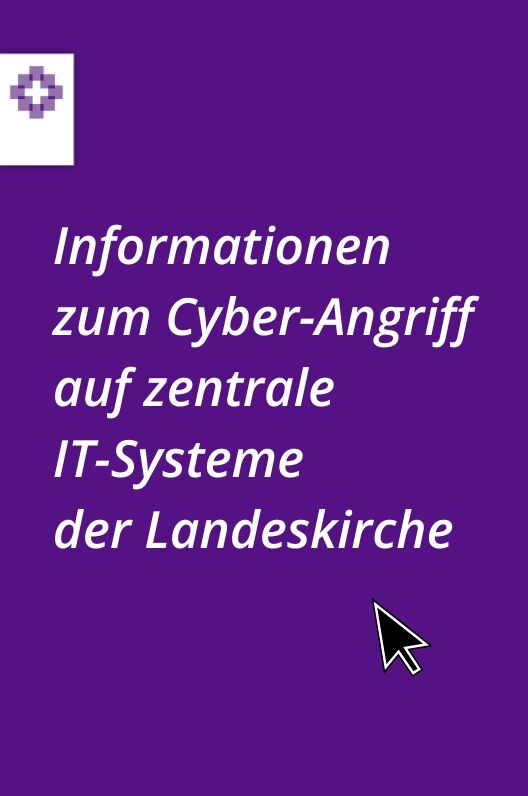Zu Beginn seines Berichtes stellte Bischof Ralf Meister klar, dass er einzelne theologische Einsichten und Beobachtungen zum Thema „Prävention, Intervention und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Landeskirche“ in seinen Ausführungen einfließen lasse. Aber in Absprache mit dem Präsidium werde er nicht der ausführlichen Behandlung dieses Themas am morgigen Freitag vorgreifen.
Kloster Loccum: „Ein Ort der Macht“
Ralf Meister ging zum Auftakt auf die Geschichte des Ortes ein, an dem die Landessynode erstmals tagt. Von den Anfängen des Klosters im 12. Jahrhundert schlug er einen großen Bogen ausgehend von der Frömmigkeit der Zisterzienser über die Hexenprozesse des 16. und 17. Jahrhunderts bis hin zur Neuzeit. Aktuell dient das Kloster als Predigerseminar und damit als Ausbildungsstätte für Vikarinnen und Vikare von insgesamt fünf Landeskirchen in Niedersachsen und Bremen. Zudem sind seit drei Jahren auch Frauen im Loccumer Konvent vertreten. „Das Kloster Loccum war durch die Jahrhunderte hindurch ein Ort der Macht“, so Meister. „Offensichtlich oder verborgen konnten Entscheidungen hier besprochen oder eingefädelt werden.“ Beispielhaft nannte er die Konfessionsgespräche zwischen Abt Gerhard Molanus und Gottfried Wilhelm Leibniz vor 200 Jahren oder die Unterzeichnung der Loccumer Verträge 1955.
Mit Bezug auf die Mystik Bernhard von Clairvauxs, der bestimmenden Gründergestalt der Zisterzienser, sagte Meister: „Den Leidenden zu sehen und die Hände zu reichen, ist die Wurzel jesuanischer Spiritualität. Diese Haltung ist uns sofort gegenwärtig, wenn wir auf die Untaten sexualisierter Gewalt in unserer Kirche schauen. Die Ignoranz, Gleichgültigkeit oder Verteidigung der Taten entsetzt. Das Verhalten kirchlicher Vertreter beschämt, auch meine eigenen Fehler in diesem Prozess, unsere unzureichende Bearbeitung und die mangelnden Begegnungen ebenso. Die Anklage der von sexualisierter Gewalt Betroffenen ist eine Autorität sui generis.“
Kirche der Zukunft
„Vielleicht wird sich die Kirche der Zukunft weniger buchhalterisch, weniger kalkuliert zeigen als erwartungsoffener“, so Bischof Ralf Meister weiter. „Was sich offenbart, wird, ohne dass es sich im Vorhinein schon abzeichnet, inspirierend, visionär, befreiend sein.“
Menschen, so Meister, seien die „überzeugendste Ressource“, in der sich die biblischen Erfahrungen wiederholten und neu ereigneten. „Wenn wir von Ressourcen sprechen, sprechen wir wesentlich von dem, was sich in uns, in den Menschen unserer Gemeinden, nicht nur der kirchlichen, auch der politischen Gemeinde, ereignet.“
Materielle Ressourcen seien die Kirchengebäude. „In unserer Landeskirche haben wir eine außerordentlich gute Situation. Nur wenige Kirchen, vermutlich weniger als 20, sind bisher abgegeben worden, doch einige werden in den kommenden Jahren folgen.“
Meister verwies in diesem Zusammenhang ein vor drei Wochen erschienenes Manifest, das inzwischen von 16.000 Personen unterzeichnet worden ist. Darin heißt es: Nicht mehr für kirchliche Zwecke benötigte Kirchen sollten auf eigens dafür errichtete Stiftungen übertragen werden. „Mit diesem Manifest“, so der Bischof, „antwortet der Sozialraum.“ Das Manifest verstehe er daher als Angebot an die Kirche zur Mitverantwortung. „Ein solches Gesprächsangebot sollte aufgegriffen werden.“
„Verantwortung für die Demokratie tragen wir alle!“
Aus Anlass des 75-jährigen Bestehens des Grundgesetzes nahm Meister in seinem Bischofsbericht auch Stellung zu Demokratie und Freiheit. „Die Begriffe von Würde und Freiheit wurden in den Jubliäumsveranstaltungen oft inflationär aufgerufen“, konstatierte er. Dabei seien sie in ihrem „ursprünglichen Verständnis“ bedroht. Zur Freiheit gehöre nämlich auch immer die Verantwortung mit einem konkreten Bezug zur Gemeinschaft, damit sie nicht in Narzissmus abgleite.
„Wie gelingt diese Verantwortungsübernahme in einer pluralen und teilweise auch polarisierten Gesellschaft, die Freiheit und Würde mit geradezu universalem Anspruch postuliert und sie doch zumeist nur partikular und individuell, dem eigenen Interesse folgend, wahrnehmen will?“, sagte Meister.
Als Kirche feierten wir unsere Demokratie und unsere Verfassung bewusst und überzeugt. Er verwies in diesem Zusammenhang auf das gemeinsame Schreiben der Ökumenischen Bischofskonferenz in Niedersachsen. Dort heißt es unter anderem: „Wir stehen engagiert, kritisch und konsequent für die Demokratie ein und steigern gegenwärtig unseren Einsatz für die Stärkung der Demokratie auf den verschiedenen Ebenen kirchlichen Lebens.“
Er unterstütze die Idee von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für ein soziales Jahr. „Ich plädiere sehr für eine soziale Pflichtzeit, um eine Kultur der Verantwortung in unserem Land wieder verstärkt einzuüben.“
Eindrücklicher Besuch in Georgien
„Ich bin vor wenigen Wochen in Georgien gewesen“, berichtete Ralf Meister vor der Landessynode. „Wir waren dort inmitten der Phase, als hunderttausend Menschen gegen ein Gesetz auf die Straße gingen, welches den Beitritt zur EU dieses ehemalige Land der Sowjetunion unmöglich machen wird.“
Meister bezog sich dabei auf das vom georgischen Parlament gegen den Protest von Hunderttausenden beschlossene Gesetz, das Initiativen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, die mehr als 20 Prozent ihrer Mittel aus dem Ausland bekommen, zwingt sich registrieren zu lassen.
Von den Gegnern dieses Gesetzes, so Meister, werde es das „Russland-Gesetz“ genannt. Er habe 2012 bei der Einführung dieses Gesetzes in Russland gerade die damalige Partnerkirche in Omsk besucht. „Was dort mit diesem Gesetz begann, die Einschränkung der Arbeit der NGOs, endete systematisch ein Jahrzehnt später in einer fast vollständigen Vernichtung zivilgesellschaftlichen Handelns, der Freiheit der Medien und der öffentlichen Meinungsäußerungen.“
Er sei von den Protesten in der georgischen Hauptstadt Tbilissi sehr beeindruckt gewesen. Denn diese vielen Menschen seien auf die Straße gegangen, „wohl wissend, dass sie inhaftiert werden konnten".
Barmer Theologische Erklärung: Teil der eigenen Tradition
Im Mai 1934 wurde in Wuppertal-Barmen eine Theologische Erklärung verabschiedet, in der sich mit Berufung auf die biblischen Schriften der Widerstand gegen die Gleichschaltung der Kirchen unter dem nationalsozialistischen Regime kristallisierte. „Diese Barmer Theologische Erklärung haben wir in der Präambel der Verfassung unserer Landeskirche aufgenommen. Diese klaren Sätze aus dem Beginn des nationalsozialistischen Deutschlands gehören in unsere Tradition“, bekräftigte Ralf Meister in seinem Bischofsbericht.
Die Stärke dieser Erklärung liege darin, dass sie für ihre politische Haltung eine theologische Begründung gäbe. „Sie benennt nach Schrift und Bekenntnis, warum bestimmte Positionen mit ihren Grundlagen unvereinbar sind.“ Es sei notwendig, eine Sprache zu sprechen, die eine geistliche Haltung formuliere, aber auch verständlich sei.
Mit Blick auf extremistische Positionen sagte Meister: „Manche AfD-Positionen und andere extremistische Haltungen sind mit christlichen Werten nicht vereinbar. Unsere Verfassung positioniert sich klar für die Demokratie und bekennt sich zu einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat, der auf der Achtung der Menschenwürde und der Menschenrechte gründet.“
Es sei aber notwendig, den Dialog im Kontrast zu AfD-Mandatsträgern diesen mit AfD-Sympathisanten nicht abreißen zu lassen, dabei aber klar die Argumente zu benennen, „die zentrale Forderungen der AfD für uns als Christinnen und Christen unmöglich machen.“
„Kirchenasyl ist ein humanitärer Notdienst“
In Bienenbüttel haben Polizei und Mitarbeitende der Landesaufnahmebehörde vor zwei Wochen ein Kirchenasyl in einem evangelischen Gemeindehaus gegen den Willen der Kirchengemeinde beendet. Ralf Meister nahm in seinem Bischofsbericht auf diesen Vorfall Bezug und erklärte, dass es im Nachgang ein Treffen mit der niedersächsischen Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, gegeben habe. Dabei habe die Ministerin klargestellt, dass „es Situationen wie in Bienenbüttel künftig nicht mehr geben soll. Das begrüße ich.“
Meister erklärte zudem, dass das sogenannte Dossier-Verfahren nicht mehr funktioniere. Dieses Verfahren sieht vor, dass jedes Kirchenasyl durch die Kirchen in einem „Dossier“ begründet und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zugestellt werde. Es entstehe aber der Eindruck, dass eine wirkliche Prüfung durch das BAMF nicht stattfinde, da es in nahezu jedem Fall eine negative Antwort durch das BAMF auf die Dossiers gebe. „Die Menschenwürde gebietet es aber, dass die Beweggründe schutzsuchender Menschen sorgfältig geprüft werden und es keine automatisierten Ablehnungen gibt“, so Meister. Daher werde es noch im Juni ein Gespräch zwischen evangelischer und katholischer Kirche auf der Ebene der bevollmächtigen Personen und dem BAMF in Berlin geben.
Klar sei aber auch: Ein Kirchenasyl begründe keinen rechtsfreien Raum. Es gehe vielmehr mit einem Vertrauensvorschuss von Seiten des Staates gegenüber der Kirche einher, dass Kirchengemeinden ihre Entscheidung sorgfältig aus humanitären und christlichen Beweggründen treffen. „Kirchenasyl ist ein humanitärer Notdienst, kein politisches Instrument.“
„Hamas hat das Ansehen Israels ruiniert“
„Das Ansehen Israels ist weltweit ruiniert, wie niemals in der Geschichte des Staates zuvor.“ Mit diesen Worten leitete Bischof Ralf Meister in seinem Bericht seine Einschätzungen zum Krieg in Israel und Gaza ein. Damit habe die Hamas, deren Ziel die Zerstörung des Staates Israel sei, ihr Ziel erreicht. Dabei habe die Terrororganisation keinerlei Rücksicht auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger genommen.
„Die Eskalationsgefahr dieses Konflikts besteht für den ganzen Mittleren Osten und die humanitäre Katastrophe in Gaza verschlimmert sich jeden Tag.“ Mit vielen hunderttausend Israelis, die dies durch ihre Demonstrationen immer wieder deutlich machten, stimme er darin überein, dass Israel „die schlechteste Regierung seit der Staatsgründung hat".
Aus dem Krieg in Israel und Gaza explodiere ein furchtbarer Antisemitismus. „Es hat immer ideologische Grundlagen gegeben für den Antisemitismus. Vermutlich waren die Kirchen die ersten, die mit dem Antijudaismus und dem christlichen Judenhass antisemitische Stereotype entwickelten, weitergeführt über den Marxismus, der über die Ideologie eines Antikapitalismus diese zerstörerische Wut weiterschürte, was übrigens auch dazu führt, dass heute radikal linke und sozialistische Regierungen weit vorne sind bei der Verurteilung des Vorgehens Israels.“
Formen der Israelkritik seien aber nicht per se Antisemitismus. „Unsere Solidarität mit Israel kann keine Unterstützung des Krieges sein.“ Denn es scheine so, als breche die israelische Armee auch das Völkerrecht, um sich auch zukünftig gegen die Gewalt der Hamas zu wehren. „Alle Verhandlungen müssen zum Ziel haben, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden.“ Es gelte aber genauso: „Unsere Solidarität mit jüdischen Menschen in unserem Land und unseren Kommunen bleibt ungebrochen.“
Halleluja für Kirchenvorstände und Multiplikatoren
Am Ende seines Bischofsberichtes würdigte Ralf Meister wieder mehrere Gruppen mit einem „Halleluja“: Es gilt zum einen den rund 6.500 Kirchenmitgliedern, die sich bei der Kirchenvorstandswahl im März in die neuen Vorstände haben wählen lassen, „Was für ein Zeichen – trotz aller Schwierigkeiten – für die Lebendigkeit unserer Kirche“, so der leitende Geistliche. Die neuen Kirchenvorsteherinnen und -vorsteher waren von einem Viertel aller Wahlberechtigten gewählt worden. Damit hatte sich die Wahlbeteiligung in der hannoverschen Landeskirche deutlich gesteigert. „Allen gewählten Frauen und Männern gratuliere ich und danke für ihre Tatkraft, ihr persönliches Engagement und ihr Erfahrungswissen, das sie mitbringen und das auf diese Weise unserer Kirche zugutekommt.“ Meister würdigte dabei auch ausdrücklich all jenen, die in den Gemeinden die erstmals auch online und als allgemeine Briefwahl organisierte Wahl verwirktlicht haben.
Zum anderen dankte Meister den bereits 139 geschulten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die sich bis jetzt im Bereich „Prävention Sexualisierter Gewalt“ als Lehrende haben ausbilden lassen. „Sie alle lassen sich schulen, um dann selbst in den Kirchengemeinden, Einrichtungen und Kirchenkreisen Grundschulungen anzubieten und so den Kulturwandel in der Fläche unserer Landeskirche mitzutragen und voranzubringen.“ Meister verknüpfte seinen Dank mit einem Vorschlag an die Landessynode: Hier sei es wichtig, kurzfristig womöglich mit finanzieller Unterstützung in den Kirchenkreisen zu helfen, damit dieser Wandel in der Fläche auch wirklich gelingen können.